|
|
 |
|
|||||||
 |
 |
|
|||||||
 |
|
|
|||||||
|
|
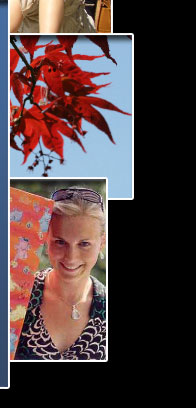 |
|
|
||||||
|
|
 |
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Stadt Wangen im Allgäu, einst freie Reichstadt, beeindruckt mit einem fast unversehrt erhaltenen malerischen Stadtkern. Umgeben von mittelalterlichen Toren und Türmen und einer zum Teil noch sichtbaren Stadtmauer, kann man die historische Altstadt bewundern. Der Marktplatz, die Herren- und die Paradiesstraße zählen mit zu den schönsten Straßenbildern in Süddeutschland. Hier wird schon seit den 70er Jahren auf den Erhalt der denkmalgeschützen Altstadt geachtet. Somit konnte Wangen seinen geschlossenen Gesamtcharakter erhalten und viele alte Patrizier- und Bürgerhäuser erhielten ihren alten Glanz zurück. Viele authentisch erhaltene und sachverständig gepflegten Details, wie z.B. die charakteristischen Malereien an den Hauswänden und die ins Stadtbild sinnvoll integrierten Wangener Brunnen, machen die Stadt zu einem liebenswerten Fleckchen mit hoher touristischer Anziehungskraft. Geschichtliche Hintergründe: Urkundlich wurde Wangen erstmals im Jahre 815 als "Wangun" erwähnt. Grundherr war das fränkische Reichskloster in St. Gallen. Die ursprünglich allemannische Ansiedlung gehörte zu dieser Zeit zu den ältesten und wichtigsten Stiftungsgütern des Klosters in Oberschwaben. Der damalige Marktflecken wurde 1217 vom Hohenstauferkaiser Friedrich II. zur Stadt erhoben. Nach dem Tod des letzten Hohenstaufen gelang es den Wangenern auch in der "kaiserlosen Zeit", ihre Unabhängingkeit von St. Gallen zu behaupten und weiter auszubauen. König Rudolf v. Habsburg besiegelte 1286 den Status als "freie Reichsstadt" endgültig. Das Symbol des Adlers für das staufische Kaisertum und das Symbol der Lilie für das fränkische Kaisertum im Wangener Stadwappen, weisen heute noch auf diese Reichszugehörigkeit hin. Die verkerhsgünstige Lage, Fleiß und Handel stärkten die Wangener Wirtschaftskraft. Im Jahre 1347 eroberten sich die Zünfte den Zugang zu städtischen Ämtern und ein Bürgermeister trat an die Spitze der Stadt. Um 1400 waren die Möglichkeiten zur baulichen Entwicklung innerhalb der bestehenden Grenzen ausgeschöpft. Deshalb ummauerte man die zwischen bestehender Stadmauer und dem angrenzenden Fluss (der Argen) gelegene landwirtschaftlich genutze Fläche die "Baind". Durch diese Eingrenzung war die Wangener unterstadt entstanden. Noch heute zeugt der Name "B(a)indstrasse", nahe der unteren Stadtmauer von diesem Ereignis. Durch die Herstellung und den Export von Sensen und Leinen, verzeichnete Wange eine gute Außenhandelsbilanz. In Ihrer Blütezeit kaufte Wangen ein großes Gebiet außerhalb der Stadtmauern auf und hatte durch dessen landwirtschaftliche Erträge auch in Notzeiten eine sichere Existenzbasis. Aber auch die Wangener kamen nicht an den schlechten Zeiten vorbei. Vor den Pestwellen blieben Sie nicht verschont und es gab außerdem mehrmals furchtbare Stadtbrände. So wurden 1539 durch die Hand eines Mordbrenners 180 Häuser und damit fast die ganze Oberstadt eingeäschert. In den Jahren 1793 und 1858 brannten ganze Straßenzüge in der Unterstadt ab. Immer wieder wurde der Friede durch Kriegszeiten unterbrochen. Der 30jährige Krieg und die Folgen der Koalitionskriege unter Napoleon waren besonders hart für die Stadt, die durch hohe Kriegslasten Ihre Schulden schließlich nicht mehr tragen konnte. Im Jahre 1802 verlor Wangen dann auch noch als Folge der napoleonischen Veränderungen seine Unabhängigkeit und wurde bayrische Amtsstadt. Völlig verschuldet kam sie dann 1810 in die Hoheit des Königreichs Württemberg. Hierbei blieben jedoch einigie Wangener Gebiete bei Bayern und noch heute teilt die dabei entsatandene Landesgrenze direkt hinter der Stadt einen historisch zusammengewachsenen Kulturraum. Als sich im 16. Jahrhundert fast alle Reichsstädte zur Reformation bekannten, bildete Wangen hier eine große Außnahme und blieb beim "alten Glauben". Erst im 19. Jahrhundert ließen sich erste evangelische Bürger in Wangen nieder. Die erste evangelische Kirche wurde 1893 eingeweiht und hat mittlerweile eine recht große Gemeinde. Erst sehr spät kam 1860 die Industrialisierung in die Stadt. Auf die Gründung der Baumwollspinnerei folgten nach Wangens Anschluss an die Eisenbahn im Jahre 1880 drei Großkäsereien, für die Wangen lange Zeit bekannt war. In dieser Zeit wuchs die Bevökerung binnen 100 Jahren um 355% auf 8.034 Personen. Durch die vielen Opfer im ersten Weltkrieg und die Wirtschaftskrise wurden viele Familien an den Rand ihrer Existenz gebracht. Ab 1933 wurde Wangen als ehemalige Zentrumshochburg für 12 Jahre von der NSDAP beherrscht. Diese Zeit haben die Wangener in dem Buch "Verdrängte Jahre? Wangen im Allgäu 1933-1945" (erschinen 1999) unfangreich aufgearbeitet. Die Bauwerke der Stadt blieben als einziges vom zweiten Weltkrieg verschont. Trotzdem gab es in der Nachkriegszeit für Wangen noch nie dagwesene Probleme. 2.500 Evakuierte, Flüchtlinge und Heimatlose führten in Wangen zu einer ernormen Wohnungsnot, die erst durch einen Ausbau von Randsiedlungsgebieten nach und nach gemildert werden konnte. Im Jahr 1972 kam es für Wangen letztmalig zu einer großen Umwälzung. Durch die Verwaltungsreformen, wurde der Landkreis Wangen aufgelöst und dem Landkreis Ravensburg zugeordnet. Im gleichen Zug wurden aber die Gemeinden Deuchelried, Kasrsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen und Schomburg in die "Große Kreisstadt Wangen" eingemeindet, wobei sich die Einwohnerzahl von Wangen schlagartig fast verdoppelte und der direkt zu verwaltende Raum sogar verzehnfachte. |